16-09-2021
„Geflochtenes Süßgras“: Über die Weisheit der Pflanzen
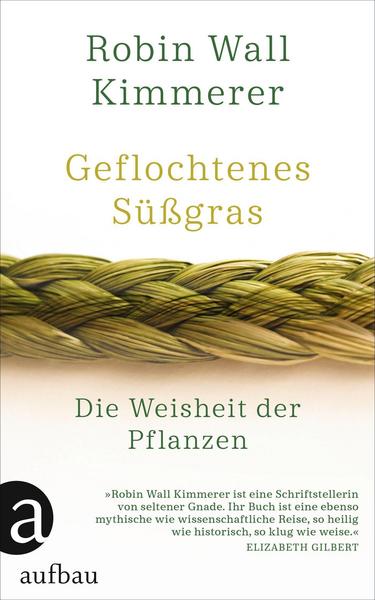
Von Wolfgang Mayr
Die Botanikerin Robin Wall Kimmerer beschreibt die Beziehung zwischen Menschen und Natur als krank. Die Welt ist aus dem Lot, die Natur gefährdet und damit wohl auch die Menschen. Das wirkt sich aus, ist spürbar, Robin Wall Kimmerer: „Es hat mich wirklich getroffen, wie viele meiner Studierenden sich fragen, ob sie noch Kinder in die Welt setzen sollen, weil sie für sie keine Zukunft sehen,“ sagt Robin Wall Kimmerer im Gespräch mit „Zeit-Wissen“.
Eine tiefe Angst vor der Zukunft, die keine mehr zu sein scheint. Deshalb wirbt Kimmerer in ihrer Essay-Sammlung „Geflochtenes Süßgras“ für eine tiefgehende Veränderung des Verhältnisses zwischen Menschen und Natur.
In Zeiten wie diesen, wo laut über den Klimawandel nachgedacht und geredet wird, erstürmte das Buch die Bestseller-Listen, kommentiert der „Deutschland-Funk“.
Vom Schöpfungsmythos der Patawatomi
Ihr Buch „Geflochtenes Süßgras“ eröffnet die Botanik-Professorin Kimmerer mit dem Schöpfungsmythos der Potawatomi. „Am Anfang war ein Sturz: Die Himmelsfrau fällt in die Welt – und wird im Flug aufgefangen von Gänsen, die sie weich absetzen auf dem Panzer einer Schildkröte.“ Das ist der Schöpfungs-Mythos der indigenen Völker im Land um die Großen Seen in Nordamerika, „ein Prozess voll gegenseitiger Fürsorge,“ findet der Deutschlandfunk.
Kimmerer schreibt einfühlsam über Pflanzen, sie widerspiegeln das Verhältnis der Menschen zur weiten Welt. Kimmerer findet für das Süßgras mit seinem vanilleartigen Duft die richtigen Worte, lesend meint man, ihn zu riechen. Die tribal nations, die Stämme der native americans an den Großen Seen, verehrten das Süßgras als Haar der Mutter Erde.
Robin Wall Kimmerer ist Angehörige der Potawatomi. Vor der „europäischen Landnahme“, die Umschreibung für Raub und Eroberung, lebten die Potawatomi – ein Volk der Anishinaabe – im Gebiet der Großen Seen. Ab 1821 wurden sie von weißen Siedlern, Milizen und von der US-Armee vertrieben, aus der grünen Prärielandschaft Wisconsins in die trockenen Hügel von Oklahoma. Sie sollten dort leben können, so lange der Fluss … Auch das blieb nur reine Ankündigung. Die Reservate in Oklahoma wurden nach dem Eindringen von Landsuchenden kurzerhand aufgelöst.
Aber das schien den weißen Eroberern nicht zu genügen, erzählt Kimmerer im Gespräch mit „Zeit-Wissen“: „Nein, als ob es nicht genug wäre, versuchten sie, uns auch unsere Sprache wegzunehmen.“ Was ja auch Großteils gelungen ist.
Indigene Renaissance
Trotzdem gelang den us-amerikanischen Ureinwohnern, das heißt indigen, eine kulturelle Renaissance, die Wiederentdeckung ihrer verschütteten Wurzeln. Das Land wurde auch wiederentdeckt, „Land ist zugleich Bibliothek, Apotheke und spiritueller Ort,“ erklärt Kimmerer in Zeit-Wissen. Und die Pflanzen verbinden die Menschen mit der Erde, mit der Natur. Wie eben das Süßgras.
Die Potawatomi-Frauen spendeten der Erde einen Tabakkrümel, bevor sie das Süßgras ernteten. Geerntet wurde nur die Hälfte der Menge. Mit dem Tausch Tabak-Gras wird klar, Mensch und Pflanze stehen in einer wechselseitigen Beziehung. Keine unbekannte Perspektive, Claus Biegert beschrieb sie bereits 1976 in seinem Buch „Seit 200 Jahren ohne Verfassung“.
In seiner Kritik wundert sich der Deutschlandfunk, dass das Buch „fast sieben Jahre unter dem Radar der Presse blieb, bis es dank Mund-zu-Mund-Propaganda von Lesern und Buchhändlerinnen im Februar 2020 die Bestseller-Liste der „New York Times“ erreichte.“ Das Buch erschien jetzt in neun verschiedenen Sprachen.
Kimmerer untersuchte mit ihren StudentInnen die naturnahe Bewirtschaftung von Süßgras. Dort, wo nach traditionellen Prinzipien geerntet wurde, wuchs das Gras besser als die sich selbst überlassenen Büschel.
Die Botanikerin ist überzeugt, dass der Mensch positiv auf die Natur einwirken kann. Ihr Appell: „Wir müssen nicht nur aufhören, der Umwelt zu schaden, sondern Verantwortung übernehmen für das Land, das Wasser und die Luft, etwa, indem wir dazu beitragen, dass verseuchte Seen wieder sauber werden.“
Der zweite Teil ihrer Botschaft: Tiere und Pflanzen sind keine Objekte, sondern die nicht-menschlichen Verwandten der Menschen. Traditionelle indigene Vorstellung, neu beschrieben von der Botanik-Professorin Robin Wall Kimmerer. Fazit des Deutschlandfunks: „Eine wegweisende Lektüre, zu der man alle verpflichten möchte, die in Politik und Wirtschaft entscheiden, wie es mit unserem Planeten weitergeht.“
Robin Wall Kimmerer: „Geflochtenes Süßgras. Die Weisheit der Pflanzen“
Aus dem Englischen von Elsbeth Ranke
Aufbau Verlag, Berlin 2021
461 Seiten, 24 Euro
ZEIT WISSEN Magazin – Die aktuelle Ausgabe
Citizen Potawatomi Nation – People of the Place of the Fire
SHARE